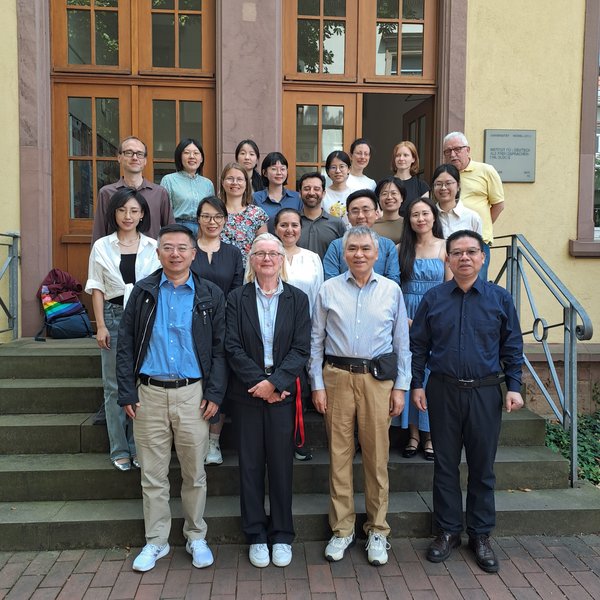Internationales und Interdisziplinäres Kolloquium für Doktorandinnen und Doktoranden
Gertrud M. Rösch und Andreas F. Kelletat (Mainz/Germersheim) veranstalteten am Samstag, 12. Juli 2025, zum letzten Mal das Internationale und Interkulturelle Doktoranden-Kolloquium.
Bericht
Bei Kaffee und Butterbrezeln kamen auch dieses Jahr gegen halb zehn morgens die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kolloquiums zusammen und begannen sofort, sich auszutauschen, denn viele kannten sich aus den früheren Jahren. Prof. Dr. CHEN Zhuangying und Prof. Dr. XIE Jianwen von der Shanghai International Studies University (SISU) waren zum wiederholten Male dabei. Zum ersten Mal nahm Prof. Dr. LI Changke (Peking Universität) teil; er konnte jedoch von allen Anwesenden auf die längste Vertrautheit mit dem Institut zurückschauen, hatte er doch von 1978 bis 1980 am IDF studiert und dabei viele der früheren Kollegen wie Joachim Wich persönlich erlebt.
Den Auftakt machte Nermin SADEK (Kairo/Heidelberg) mit ihrem Vergleich der Romane ‚Heimsuchung‘ (2008) von J. Erpenbeck und ‚Dhat‘ (1992) von S. Ibrahim. Dieser Vergleich wurde plausibel, als Frau SADEK die Frauenfiguren und die Rolle der Räume zu erklären begann. ‚Im Raum lesen wir die Zeit‘ – gemäß diesem Buchtitel (2006) von Karl Schlögel will sie die Veränderung der Figuren und historischen Kontexte darstellen. Auf die Frage nach der Titelfigur Dhat (XIE Jianwen) ergab sich ein ganzes Netz von Erklärungen: ‚Dhat‘ bedeutet ‚Selbst‘, weist somit auf die Identität der Figur wie auf die vielgelesene Autobiographie (In Search of Identity; dt. Auf der Suche nach dem Selbst. Die Geschichte meines Lebens, 1978) von Anwar el-Sadat. Sofort trat damit die Frage in den Mittelpunkt, die viele Diskussionen dieses Kolloquiums bestimmte und in all den Jahren bestimmt hatte: Wie lesen wir Texte, die aus einem anderen Zusammenhang von Kultur und Geschichte stammen?
Jelena POKRAJAC (Heidelberg) führte in ihrer schon weit vorangeschrittenen Arbeit mitten in die Forschung zu Thomas Mann und C. G. Jung und argumentierte zugleich mutig gegen die überwiegende Festlegung auf Sigmund Freud, der stets prominenter behandelt wird als sein Schüler C.G. Jung. Dies hänge mit Jungs Nähe zum Nationalsozialismus zusammen, von Mann im Tagebuch als „sich schlecht benehmen“ kommentiert. Sie beabsichtige keine Einflussforschung, sondern wolle Theorie und fiktionale Narration in Beziehung setzen und die sich überschneidenden Schwerpunkte herausstellen.
Relevante und kontroverse Themen griffen die beiden nächsten Referentinnen auf. Am Beispiel der Erzählung ‚Die verlorene Ehre der Katharina Blum‘ (1974) zeigte LI Shuwei (Heidelberg) etwa im Vergleich der Vorworte zur Übersetzung von 1977 und 2018, wie dem Publikum „der chinesische Böll“ (Andreas F. KELLETAT) präsentiert werde. Die Materialbasis einer solchen Rezeptionsstudie kann prinzipiell unendlich sein, denn nicht nur Paratexte gehören dazu, sondern auch Lehrbücher, so die Frage von LI Changke, in denen die Textauswahl und die Fragen steuern, wie Lernende Bölls Werke verstehen können und sollen. – WANG Shan (Heidelberg) hatte mit dem Journalisten und Reiseschriftsteller Colin Ross (1885-1945) einen klar dem Nationalsozialismus verbundenen Autor gewählt, der mit der Darstellung Mandschukos in seinem Buch ‚Das neue Asien‘ (1940) ein schwieriges Kapitel der chinesisch-japanischen Geschichte darstellte. Sehr schnell tauchten die Fragen auf, wie sich die Detailanalyse des Textes von 1940 zwischen den historischen Perspektiven in China und Deutschland damals und heute positionieren könne.
Die Mittagspause mit Melonen und Mozzarella mit Tomaten war der sommerlichen Jahreszeit angemessen, auch wenn dieser Samstag keineswegs so heiß ausfiel wie in den Wochen davor. Vergessen wurde auch nicht das offizielle Foto vor dem Eingang des Bunsen-Gebäudes, das 1855 errichtet wurde, um den damals schon berühmten Wissenschaftler zum Wechsel von Berlin nach Heidelberg zu bewegen. – Nicht hoch genug zu schätzen ist die über die Jahre gewachsene Hilfsbereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Frau Kroll und Frau Brauch bei den organisatorischen Aufgaben im Hintergrund und bei der Besorgung des Büffets unterstützten. Ganz herzlich sei hier allen gedankt, die spontan mithalfen und in praktischer Weise zum Gelingen des Tages beitrugen.
SONG Xin (Heidelberg), mittlerweile gut vertraut mit dem Deutschen Literaturarchiv (DLA) Marbach, führte unter dem Titel „Ins Archiv, aus dem Archiv“ seine Manuskriptforschung zu den Musikerromanen Peter Härtlings vor und wählte als Beispiel ‚Schumanns Schatten‘ (1996). Er belässt es in seiner fortgeschrittenen Studie nicht bei einer Darstellung der Musikerromane Härtlings in der Überschau, sondern will exemplarisch in der Analyse der ersten und zweiten Manuskript-Fassung des Schumann-Romans auch die narrative Technik beschreiben. Insbesondere geht es um die Tendenz der jeweiligen Streichungen und Weglassungen, aus denen die eigene Rolle als Erzähler deutlich werde.
Aus Germersheim waren erneut LIU Xiao und ZHANG Haoyu gekommen, die beide schon als Übersetzerinnen tätig sind. LIU Xiao führte ein Teilkapitel aus der Geschichte des Verlags für fremdsprachige Literatur Peking aus und stellte die chinesischen Bücher auf der Leipziger Buchmesse und das entsprechende Vertriebsnetz in den Jahren 1949 bis 1961 vor. – ZHANG Haoyu konzentrierte sich diesmal auf die Übersetzungen aus dem Chinesischen, die in der Zeitschrift ‚Ostasiatische Rundschau‘ (1920–1944) erschienen waren. Ergebnisse ihrer häufig originären und archivgestützten Recherchen präsentieren die AbsolventInnen der dortigen Abteilung regelmäßig im ‚Germersheimer Übersetzerlexikon‘ UeLex (https://uelex.de/).
Die Schlussbesprechung, traditionell der Suche nach dem Termin für das Kolloquium im folgenden Jahr vorbehalten, wurde diesmal zur Schlussrede auf die gesamte Veranstaltungsreihe. Gertrud M. RÖSCH hatte dieses Kolloquium nach ihrer Berufung 2006 zusammen mit Andreas F. KELLETAT initiiert und gemeinsam in lückenloser Folge durchgeführt. Von einer detaillierten Rückschau auf diese zwanzig Jahre waren sie und die Zuhörenden (die alle schon erwartungsvoll die Sektgläser in den Händen hielten) jedoch befreit, dank der Netzseite, auf der die Programme und Berichte dieser Jahre nachzulesen sind. Stattdessen erinnerte sie an die Motivation zu diesem Unternehmen. Vor dem Entstehen von Doktorandenschulen und Graduiertenakademien gestaltete sich die sog. Individualpromotion meist als ein einsames Unternehmen. Doktorväter und -mütter, um diesen ehrwürdigen Terminus zu gebrauchen, boten Sprechstunden und Oberseminare an, aber stets in der wohlwollenden Annahme, dass die Kandidatinnen und Kandidaten die Hürden des Themas wie die Zweifel und Selbstzweifel schon bewältigen würden – was ja in den allermeisten Fällen zutraf (wer es nicht packte, verschwand von der akademischen Bildfläche und damit auch aus der Statistik). Ausgenommen von dieser Kritik blieb ausdrücklich der Betreuer ihrer eigenen Promotion in Regensburg, war er es doch, der den Doktorandinnen und Doktoranden jeden Montag die akademischen Stellenausschreibungen aus DIE ZEIT ins Postfach legte, darunter auch jene Anzeige, die Gertrud M. RÖSCH 1989 auf ihre erste Arbeitsstelle an die University of Otago in Dunedin (Neuseeland) führte. So gesehen spiegeln die zwanzig Jahre des Kolloquiums sowohl ein Stück Fachgeschichte wie auch – stärker noch – den Wandel der Universität hin zur bewussten Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Wie jedes Mal in den letzten Jahren berichtete zum abendlichen Ausklang Andreas F. KELLETAT (Germersheim, jetzt emeritiert) in einer Lesung von seinen aktuellen Projekten. Dieses Mal waren es schockierend konkrete Gedichte einer Autorin, die unter dem Pseudonym Julia Renner publiziert hatte. Ihre Verfasserin war Juliette Pary (d.i. Yulia Gourfinkel, geb. 26. August 1903), deren Familie aus dem toleranten jüdischen Milieu der Stadt Odessa stammte. Ihre Schwester Nina und sie emigrierten mit einem Nansen-Pass nach Paris und bauten sich eine neue Existenz auf durch Übersetzungen und Schreibarbeiten. Juliette begann sich für benachteiligte Jugendliche in den Vorstädten zu interessieren, leitete Ferienlager und schrieb über ihr Anliegen, die Erziehung der Erzieher, das Buch ‚Meine 126 Gören‘ (Flammarion 1928). In Paris arbeitete sie auch mit Hannah Arendt zusammen und bildete junge Leute aus, damit sie Arbeiter und Bauern werden konnten. 1936 waren auf diesem Weg schon über 2000 junge Leute durch Auswanderung nach Palästina gerettet worden. Nach der Besetzung 1940 flüchteten Juliette und ihr Mann und ihre Schwester nach Süden, ihnen gelang der Übertritt in die Schweiz. Wie ein Schock traf sie im Herbst 1944 die Nachricht über die Realität der Vernichtungslager, daraufhin entstanden die Gedichte im Buch ‚An die Deutschen‘, die damals mit einmütigem Schweigen aufgenommen wurden. 1950 ertrank sie in Vevey unter ungeklärten Umständen. Von ihrer Schwester Nina stammen die Erinnerungen ‚Unter dem Himmel zweier Welten‘ (1946).
Juliette Pary: An die Deutschen. Gedichte. Mannheim: persona Verlag / Lisette Buchholz 2025. Die Neuedition wird im September erscheinen.
Programm
Samstag, 12. Juli 2025 (Präsenz, Raum 013 IDF)
09:30 Uhr Ankommen am Kaffee-Büffet (Raum 012 IDF)
10.00-13.00 Uhr
SADEK Nermin (Kairo/Heidelberg): ‚Heimsuchung‘ (2008) von J. Erpenbeck und ‚Dhat‘
(1992) von S. Ibrahim: Ein Vergleich
Jelena POKRAJAC (Heidelberg): Thomas Mann und C. G. Jung
LI Shuwei (Heidelberg): Heinrich Böll in China. Die Rezeption von ‚Die verlorene Ehre der
Katharina Blum‘ (1974) als Fallbeispiel
WANG Shan (Heidelberg): Die Darstellung Mandschukos in den China-Berichten des Journalisten Colin Ross (1885-1945)
13.00-14.00 Uhr Mittagspause (Raum 012 IDF)
14.00-17.00 Uhr
SONG Xin (Heidelberg): „Ins Archiv, aus dem Archiv.“ Zur Manuskriptforschung im DLA
Marbach am Beispiel von Peter Härtlings Musikerroman ‚Schumanns Schatten‘ (1996)
LIU Xiao (Germersheim): Die deutsche Übersetzungsgeschichte des Verlags für Fremdsprachige Literatur Peking 1949-1976. Ein reflektierender Überblick zum Stand der Dissertation
ZHANG Haoyu (Germersheim): Die ‚Ostasiatische Rundschau‘ (1920–1944) und ihre Übersetzungen aus dem Chinesischen – Ein Bericht über den Stand meiner Arbeit.
17.00-17.30 Uhr Schlussbesprechung
17.30-18.00 Uhr Pause
18.00-19.00 Uhr
Andreas F. KELLETAT (Germersheim): Lesung